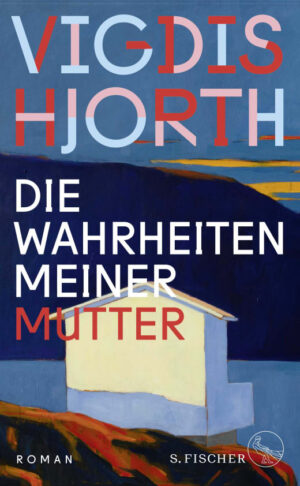Worum geht’s?
Johanna, bildende Künstlerin mit Erfolg in den mittleren Jahren, hat zum ersten Mal eine große Einzelausstellung in ihrer Geburtsstadt Oslo. Aus diesem Grund zieht sie dorthin zurück, nachdem, wie im Verlauf der Ich-Erzählung deutlich wird, ihr Mann krankheitsbedingt gestorben und der Sohn mit eigener Familie ein eigenes Leben führt.
Schnell wird deutlich: Johanna hat keinen Kontakt mehr zu der Mutter und nicht zu der eigenen Schwester, von formellen Briefen zu Geburten, Taufen und Todestagen abgesehen. Auch war Johanna nicht zur Beerdigung ihres Vaters zurückgekehrt.
Johanna fängt an, den Kontakt zu der Mutter zu suchen. Diese jedoch verweigert sich diesem, und Johanna beginnt, die Mutter und das Leben der Mutter und Schwester zu stalken. In diesem immer stärkeren Besessen-Sein mit dem Leben der Mutter kommen bei Johanna immer mehr Erinnerungen an die eigene Kindheit, Jugend und den Bruch zwischen ihr und den Eltern hoch. Johanna hat sich mit ihrer Lebensentscheidung einer Trennung und dem Fortziehen zusammen mit ihrem neuen Partner nicht akzeptiert, gehört und anerkannt gefühlt von den Eltern, und der Kontakt ist in Folge eingeschmolzen auf formelle höfliche Anteilnahmen. Johanna trägt eine große Wunde in sich und will verstehen. Verstehen, indem die Mutter ihr erzählt, wieso sie so gehandelt hat wie sie gehandelt hat in Johannas Kindheit und Jugend.
Das Bedürfnis von Johanna nach Klärung spitzt sich immer weiter zu…
Was sonst noch?
Der Roman ist fesselnd geschrieben und hat mich von der ersten Seite an in die Geschichte hereingezogen. Als Ich-Erzählung fällt es zunächst leicht, die Perspektive von Johanna zu hören, nachzuempfinden und mitzufühlen. Desto stärker aus meiner Sicht jedoch ihr Stalking beginnt und ihr Wunsch, die Mutter zur Rede zu stellen, umso gruseliger wird es auch für mich.
Es wird deutlich: Johanna geht davon aus, dass es eine eindeutige, objektiv zu teilende Realität gäbe und dass sie selbst ihre Deutungsmacht verliert, wenn nicht die Mutter diese bestätigt. Da es um strukturelle Gewalt, Ausschlüsse und Verschweigen in der Bio-Familie geht, ist das für mich mehr als nachvollziehbar. Johannas Autonomie bröckelt zunehmend in dem eigenen Sein in örtlicher Nähe zur eigenen Kindheit und Jugend sowie der Bio-Familie. Gleichzeitig gibt sie der Mutter durch ich eigenes Bedürfnis von dieser gehört zu werden und von ihr etwas zu hören, eine unglaubliche Macht, die ich mitunter schwer auszuhalten fand. Aber genau darum geht es ja vielleicht auch: wie weit gehe ich mit im Erzählen und Identifizieren? Wann wird mir etwas zu viel und was hat das mit meinen eigenen Lebensentscheidungen und Umgangsweisen mit struktureller Gewalt zu tun?
Der Roman ist ein spannungsgeladenes, kurzweiliges und tiefgehendes Leseerlebnis und unbedingt zu empfehlen für alle, die sich mit den langfristigen Umgangsweisen mit struktureller Gewalt beschäftigen wollen. Spannend ist hier auch die Gegenüberstellung von der Mutter, Johanna und Johannas Schwester, die alle unterschiedliche Wege des Umgangs mit Gewalt wählen in ihrem Leben. Die thematischen Parallelen zu Vigdis Hjorths Buch Ein falsches Wort, mit dem sie berühmt geworden ist, sind stark und eröffnen in der Zusammenschau beider Romane eine komplexe Auffächerung verschiedener Positionen im Gefüge des Funktionierens struktureller Gewalt in Bio-Familien-Systemen.
[Rezension von Lann Hornscheidt]
Vigdis Hjorth: Die Wahrheiten meiner Mutter (2023). Frankfurt: S. Fischer.
Übersetzung aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs.
Link zum Roman auf der Homepage des Verlags
Copyright Coverfoto: S. Fischer