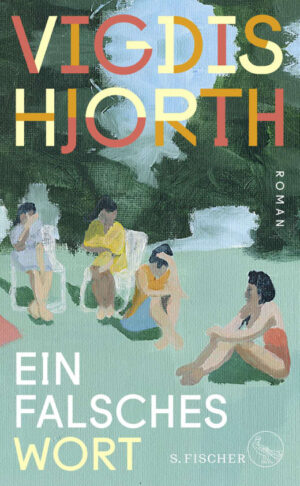Worum geht’s?
Der Vater ist gestorben und es beginnt eine Erbschaftsgeschichte um die hinterbliebene Mutter und die vier Kinder: Bergljot, die älteste Tochter, sowie den Bruder Bård, die Schwester Astrid und Åsa, die Jüngste.
Was zunächst wie ein klassischer Erbschaftsstreit beginnt zwischen lange erwachsenen Personen, der sich daran entzündet, dass Bergljots Bruder kritisiert und nicht akzeptiert, dass nur die beiden Jüngsten die Sommerhütten der Familie auf einer kleinen Insel erben sollen. Wie Bergljot hatte auch der Bruder aus eigenen Gründen keinen Kontakt zu den eigenen Eltern. Ausgehend von diesem Grundkonflikt entblößt sich bald jedoch die Langwierigkeit und über Jahrzehnte andauernde Wirkung einer Gewaltgeschichte: Der gerade gestorbene Vater hat der Ich-Erzählerin Bergljot in der Kindheit sexualisierte Gewalt zugefügt. Diese hat dies irgendwann in den 30ern ihres eigenen Lebens nach einer Trennung und einer psychischen Krise angesprochen, den Vater und die Mutter damit konfrontiert und es mit den Geschwistern geteilt – und ist über die kommenden Jahrzehnte weitgehend auf Schweigen, Verdrängen, Runterspielen und Isolierung gestoßen. Gleichzeitig kann Bergljot eine gewisse Zugehörigkeit zu der Bio-Familie nicht loslassen, die sich unter Anderem darin ausdrückt, dass Bergljots Kinder weiterhin die Geburtstage und Weihnachten ein stückweit zumindest mit den Großeltern und der Großfamilie verbringen.
Nun, zur Eröffnung und Durchführung der Erbschaftsangelegenheiten sind die Mutter und die jüngeren Schwestern auf der einen Seite um eine reibungslose, nach außen friedlich wirkende Kommunikation bemüht, während Bergljot und ihr Bruder nicht so nahtlos über das Schweigen der Familie hinweg gehen können. Aus dieser Konstellation entwickelt Vigdis Hjorth einen extrem fesselnden Plot, der die unterschiedlichen bio-familiären Strategien des Weghörens, Kleinredens, Androhens und vielem mehr beeindruckt herausarbeitet und aufzeigt, welche Wirkungen dies auf das gesamte Leben der geschädigten Person haben kann. Wie auch in Vigdis Hjorths Roman Die Wahrheiten meiner Mutter geht es auch hier darum, wie eine Person, die Gewalt im bio-familiären Kontext erlebt hat, ihr Leben lang damit zu kämpfen hat, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und nicht die durch die Bio-Familie angebotenen Verdeckungen mitzumachen – und welchen Preis dies hat. Dies ist erschütternd und aufwühlend und leider sehr lebensnah. Für Menschen, die diese Form der Gewalt erlitten haben und den verschweigenden Kontext der Bio-Familie erleben mussten, ist dieses Buch ermutigend, der eigenen Wahrnehmung zu trauen. Alle, die eine solche Gewalt erlebt haben, werden hier unterschiedliche Strategien der Tätens und Mittätens wieder erkennen.
Was sonst noch?
Vigdis Hjorth ist für diesen Roman bei seinem Erscheinen in Norwegen angegriffen worden – was dem Repertoire an gesellschaftlichen Umgangsweisen mit sexualisierter Gewalt in Bio-Familien damit also noch eine weitere Dimension schenkt.
Der Roman ist stark und wichtig. Geschrieben aus der Ich-Perspektive der geschädigten Person bezieht der Roman ganz klar Stellung und ermöglicht Diskriminierten ein Leseerlebnis, in dem sie ihrer eigenen Erfahrungen und ihren Umgang mit einem durch bio-familiäre Gewalt gezeichneten Leben wiederfinden und an sich glauben können.
Eine uneingeschränkte und unbedingte Leseempfehlung!
[Rezension von Lann Hornscheidt]
Vigdis Hjorth: Ein falsches Wort (2024). Frankfurt: S. Fischer.
Übersetzung aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs.
Link zum Roman auf der Homepage des Verlags
Copyright Coverfoto: S. Fischer